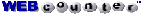Professor Dr. Gerhard Vollmer, einer der renommiertesten Mitherausgeber unserer Zeitschrift "Aufklärung und Kritik, schrieb unlängst in der "ZEIT"(1): "Hauptaufgabe der Philosophie ist gar nicht das Antworten, sondern das Fragen. ... Naturalismus in der Philosophie ist die Auffassung, daß es überall in der Welt mit rechten Dingen zugeht, auch beim Menschen: beim Sprechen, Erkennen und Denken, beim wissenschaftlichen Forschen, moralischen Handeln und ästhetischen Urteilen. Evolutionäre Erkenntnistheorie (die sich durchsetzt), Evolutionäre Ethik (die entworfen wird), Evolutionäre Ästhetik (die es noch nicht gibt) sind Teile eines solchen naturalistischen Programms. Sie setzen die unvollendete Aufklärung fort." (2) In diesem Sinne möchte dieser Beitrag Ihre Aufmerksamkeit auf jenes Gebiet der Ästhethik lenken, das nach Vollmers Worten unter dem evolutionären Blickwinkel noch terra incognita ist. I. Was ist Fühlen? Auf den ersten Blick mag es zunächst nicht ganz einsichtig sein, warum die Frage nach der Herkunft des Schönen scheinbar willkürlich mit der nach dem Wesen des Fühlens verbunden wird. Nun, überall wo man sich nach einer Theorie der Ästhetik erkundigt, ist die Rede von der "Empfindung des Schönen": Warum und was etwa an einem Bild von Picasso schön sei, kann nur vordergründig rational beurteilt werden, letztlich fällt die Entscheidung, ob ein Werk der bildenden Künste dem Betrachter gefällt oder nicht, völlig subjektiv auf der Ebene des Gefühls, ob es ihn also positiv anspricht, desinteressiert läßt oder gar abstößt. Daher erscheint es zunächst jedenfalls als unauflösliches Rätsel: Was der eine schön findet, ist dem andern häßlich, soviele Einzelmenschen, ebenso viele Begründungen für die Herkunft und das Wesen der Schönheit; bei jedem Denker, der nur ein wenig auf sich hält, eine eigene "Ästhetik" – auf den ersten Blick scheint es unmöglich, sich da durchzufinden. Die Beurteilung, ob etwas "schön" sei oder nicht, erfolgt offenbar auf eine Weise, von der man sich selbst nicht Rechenschaft zu geben in der Lage ist, wie bei allen anderen Gefühlen auch, und daher sind wir leicht geneigt, das Fühlen als unseren eigentlichsten und innersten Beurteilungsmaßstab heranzuziehen, wie es etwa Freud tat, indem er hier seine "dritte Kränkung" des Menschengeschlechts ansetzte, das nicht "Herr im eigenen Hause" sei. Ähnlich steht es bei Damasio, der in "Descartes‘ Irrtum" die wesentliche Bedeutung der Emotionen hervorhebt, wie auch bei Goleman‘s "Emotionale(r) Intelligenz": beide wollen uns daran erinnern, daß die Ratio nicht für sich allein steht, sondern in jedem Falle mit Gefühlen verbunden ist. Merkwürdigerweise habe ich für dieses Phänomen des Fühlens, dessen Bedeutung man so herausstreicht, fast nirgends, sei es in der Naturwissenschaft, sei es in der Philosophie, eine überzeugende Theorie finden können. Denn entweder wird das Fühlen, etwa bei Freud, mit dem "Unbewußten" fast schon in die Nähe der Metaphysik gerückt(3), oder aber es wird "materialisiert", d.h., auf chemisch-elektrische Vorgänge reduziert. In beiden Fällen überspringt man dasjenige, was das Besondere des menschlichen Fühlens denn an sich sei. Ähnlich wie früher hinsichtlich des Denkens wird seine Natur nicht eigentlich problematisiert, sondern nur die Frage, warum der Mensch sich "gut" oder "schlecht" fühlt, und daß es besser sei, sich "gut" zu fühlen, was dann meist als "Glück" bezeichnet wird. Dies geht in den Kognitionswissenschaften so weit, daß man dort ganz bewußt die emotionalen Bestandteile des Bewußtseins ausblendet, weil sonst die Aufklärung dessen, was Denken sei, nur noch mehr erschwert werde(4). Hingegen bekommt der Reduktionist das Fühlen überhaupt nicht in den Blick, weil er es auf physiologische Prozesse, etwa den Anstieg von Endorphinen, zurückführt, und damit die eigentliche psychische Bedeutung aus den Augen verliert. Aber auch noch die Psychologie übergeht – wenn sie sich mit den einzelnen Gefühlen befaßt wie Liebe, Tauer, Neid oder Haß – die eigentliche Grundstruktur des Fühlens an sich. Die Begriffe Gefühl und Empfindung werden – nicht nur umgangssprachlich – ganz ähnlich wie Verstand und Vernunft meist synonym verwendet; wenn aber unsere Sprache für beide Fälle verschiedene Begriffe aufweist, so könnte es vielleicht erhellend sein, ihren je eigenen Bedeutungsgehalt einzugrenzen und so statt eines regellosen Nebeneinanders ein sinnvolles Mit- und Zueinander zu erhalten. Dies insbesondere dadurch, indem wir die verschiedenen Begriffe mit dem evolutionären Aufbau unseres Gehirns zusammenstellen: inzwischen ist (fast) jedem Laien bekannt, daß wir verschieden alte Areale des Gehirns zu unterscheiden haben (Stammhirn, Kleinhirn, Großhirn), die nach wie vor auch beim Menschen wirksam und miteinander verbunden sind. Statt aber diese Areale in ihrer phänomenalen Äußerungsweise unverbunden nebeneinander zu stellen, scheint es sinnvoller, ihr funktionales Auseinanderhervorgehen und Miteinander zu klären – und dies eben in der Weise, daß bestimmten Leistungen bestimmte Begriffe zugeordnet werden, etwa im Verhältnis von Verstand und Vernunft, und so auch im Hinblick auf Empfindung und Gefühl. Um Gefühl und damit auch die "Empfindung des Schönen" zu verstehen, brauchen wir also eine Theorie des menschlichen Geistes, wie wir zumindest schematisch seine Leistungen evolutionär auseinander hervorgehend verstehen können. Am Ende dieser Arbeit finden Sie eine Grafik, welche diesen Aufbau einzufangen versucht sowie Darstellungen des menschlichen Gehirns. Ein solcher Frageansatz zwingt als erstes dazu, einen einseitigen reduktionistischen "bottom up"-Ansatz zurückzuweisen, der alle Erklärung ausschließlich "von unten nach oben" leisten will. Die bedeutsamen Leistungen und Auswirkungen von Instinkt, Emotio und Ratio werden durch ihre Rückführung auf die physiologische Basis von Botenstoffen, das Zusammenspiel von axonalen Verbindungen und dendritischen Synapsen der Neuronen ebensowenig verstanden, wie die bloße Zusammensetzung von bestimmten Atomen die neuen Eigenschaften daraus hervorgehender Moleküle erklären kann. Vielmehr müssen wir uns – und das hat die Kognitionswissenschaft inzwischen durchaus erkannt – neben dem reduktionistischen "bottom up"- vor allem auch dem sogenannten "top down"-Ansatz zuwenden, d.h., wir müssen von den spezifischen Leistungen auf das entsprechende Vermögen, also "von oben nach unten" schließen, selbstverständlich immer im Hinblick auf die jeweilige Basis – und so sehen wir, daß die Vernunft sich auf den Verstand als ihren Vorläufer gründet ebenso wie dieser sich auf die Empfindung der Emotio. Dieses Phänomen des Hervortretens qualitativ neuer Systemeigenschaften, die sich einer rein reduktionistischen Erklärung entziehen, wird in der Wissenschaft als Emergenz bezeichnet(5). Die hauptsächliche emergente Systemeigenschaft der Vernunft ist es, von den Dingen selbst auf deren Wesen als den Inbegriff ihrer wesentlichen Eigenschaften zu schließen, diejenige des Verstandes besteht darin, die Daten der Einzelsinne zu Dingen zusammenzufassen und damit auf den Begriff zu bringen. Was ist dann Gefühl? Fühlen ist in Verstand übersetztes Empfinden, in dem der Verstand das Vorhandenseins von Empfindung erfährt. Die eigentlichen menschlichen Gefühle – neben dieser Öffnung der Empfindungen für den Verstand – entstehen aus der emotionalen Bewertung und gesonderten Speicherung der Dingerkenntnisse und -benennungen des Verstandes. Damit wissen wir immer noch nicht, was denn Empfindung sei – und dazu müssen wir uns zunächst klarmachen, wofür eigentlich so etwas wie ein Gehirn "gut" ist: alle seine Makrosysteme vom Instinkt bis zur Vernunft haben die Aufgabe, zur Erhaltung und Fortpflanzung des Organismus Information mittels Wahrnehmung und Interpretation zu sammeln, diese zu verarbeiten und zu speichern. Denn unter sich ändernden Umweltbedingungen, wie sie auf unserer Erde herrschen, sind diejenigen Lebewesen im Vorteil, die sich durch repräsentierende Information auf diese Änderungen einstellen können; hingegen sind die Spezialisten zwar unter gleichbleibenden Bedingungen im Vorteil, bei Änderungen jedoch zum Untergang verurteilt. So führt die Tatsache der veränderlichen Umwelt zur Auslese derjenigen Lebewesen, die als "Generalisten" am anpassungsfähigsten sind, und daher zu einer a posteriori sich als Teleologie ausnehmenden Entwicklung von Ratio als des bisherigen Höchstandes von Informationsverarbeitung.(6) Informationsspeicherung besteht in einer genetischen oder individuellen neuronalen Engrammierung; diese Engrammata sind wiederum mit verschiedenen Verhaltensmustern konditioniert. Auf instinktiver Ebene löst ein zu einem genetischen Engramm passendes Sinnessignal "automatisch" das dazu gehörende Verhalten aus, etwa wenn der Frosch die Fliege als seine Nahrung "erkennt" und fängt; hingegen erlaubt die Eigenempfindung von Lebewesen deren individuelle Konditionierung. Individuelle Auswertung von neuronaler Information und von dieser Auswertung abhängige Reaktion finden wir mithin erst auf der Stufe der Empfindung, und sie besteht immer in einem Vergleich: ob ein Sinnesreiz einer gespeicherten Information gleich, ungleich oder ähnlich ist. Daher müssen wir davon ausgehen, daß wir ab dieser Stufe ein "individuelles Bewußtsein" anzunehmen haben, da dieser Vergleich individuell innerhalb eines bestimmten Gehirnbereiches unter Hemmung der instinktiven Automatik vorgenommen werden muß. Als Beispiel für diese individuelle Prägung mag hier die Mutter-Prägung von Vögeln stehen: der erste Gegenstand, der in den Blick der Neugeborenen gerät, wird unausweichlich als "Mutter" engrammiert, die dazugehörigen genetischen Verhaltensmuster werden mit der Wahrnehmung dieses Gegenstandes verbunden(7). Offenbar haben wir es hier bereits mit einer individuellen Informationsspeicherung zu tun, die jedoch noch nicht individuell, sondern genetisch gesteuert ist – also die Rezeptionsstufe dessen, was wir "Empfindung" nennen: die individuelle Informationsverarbeitung als ein qualitativ neues Vermögen, das zwar unlöslich mit den genetischen Programmen (Instinkt) und deren Verhaltensmustern verbunden ist, durch das aber die Auslösung der Verhaltensmuster individuell gesteuert werden kann. Beobachten wir die eigentliche emotionale Steuerung am Fluchtverhalten: nähert sich ein Raubtier einer Herde von Wildtieren an einer Wasserstelle, so werden die Tiere zunächst unruhig und beobachten "argwöhnisch" die Annäherung, ohne sich jedoch zunächst bei der Wasseraufnahme stören zu lassen. Die "Spannung" innerhalb der Herde "steigt", d.h. die sensorischen Wahrnehmungen mittels Seh- und Geruchsinn bewirken eine hormonale Ausschüttung, deren Anstieg von dem als Emotio bezeichneten Zentrum abgegriffen wird. Einzelne Tiere werden immer unruhiger, während andere noch standhalten (individuell konditionierte Empfindung). Eine bestimmte Nähe des Raubtieres löst das allgemeine Fluchtverhalten in dem Moment aus, wenn der empfindend wahrgenomme Anstieg der hormonellen Ausschüttung bei den Führungstieren die individuell durch spielendes Lernen und spätere Erfahrung verschieden vorkonditionierte Erträglichkeit übersteigt. Dieses neue Vermögen, Emotio genannt, das die Lebewesen zu individuellem Lernen befähigt, können wir uns als eine Art "skalierbares Potentiometer" vorstellen, verbunden mit einem über die Reihe der empfindenden Arten zunehmenden eigenen Speicherbereich(8). Wie jeder Mensch an sich selbst feststellen kann – aber eben auch nur an sich selbst –, ist "Empfinden" die innere Selbstwahrnehmung der Auswirkung von über die Sinnes- und Körperorgane dem Gehirn zugeleiteten sensorischen "Ereignissen"; der Inhalt der Sinneswahrnehmung und die dieser zugemischte emotionale Bewertung sind etwas Verschiedenes. Ein die Latenzschwelle überschreitender und damit "Aufmerksamkeit" erheischender Sinnesreiz macht sich durch den Anstieg von positiver oder negativer Empfindung geltend, die das Individuum zu entsprechenden Handlungen bewegen soll. Was genau aber ist "positive" und "negative" Empfindung? Es ist der Abgriff des Ansteigens oder Abfallens von hormonalen Botenstoffen, ausgelöst durch sensorische oder körpereigene (vegetative) Ereignisse, die bereits auf der Ebene des Instinkts das Verhalten steuern. Der Abgriff der Differenzierung der Emotio als Selbstempfindung erlaubt erst ein abgestuftes Verhalten in der Reaktion: der erfahrenen Empfindungsinstensität entspricht die dadurch hervorgerufene Intensität der Handlung. Die neuronale Basis der "Chemie der Psyche" ist nicht Gegenstand, zu den verschiedenen Botenstoffen und der Beeinflussung des Neurons an dessen Synapsen und Rezeptoren darf ich etwa auf die Darstellung von Crick verweisen. Hervorheben möchte ich nur, daß die Empfindung nicht in dieser neuronalen Synapsenveränderung besteht, sondern vielmehr in deren abgreifender Reflexion als Empfindung. Denn diese Steuerung von Neuronen über Botenstoffe finden wir bereits bei Tieren, die noch nicht über Empfindung verfügen, weil ihnen diese Reflexion fehlt, so etwa bei allen Arten, die nur Instinkte haben wie etwa die Amphibien. Empfindung ist also die Auswertung der Erregungssteigerung, die durch die Anlagerung der Botenstoffe hervorgerufen wird. Das "System Emotio" basiert zunächst auf den "Daten" des Instinkts und arbeitet mit diesen, wie dies ebenso im Verhältnis von Verstand und Emotio bzw. Vernunft und Verstand gilt. Hier wird schematisch der Schichtenaufbau der verschiedenen Vermögen sichtbar, wie wir ihn in der schichtweisen neuralen Verarbeitung wiederfinden. Zwar werden die neuronalen Signale parallel im 10 Millisekunden-Takt verarbeitet, aber bei diesen Verarbeitungsschritten projezieren die Neuronen insgesamt in serieller Reihenfolge nacheinander in andere Schichten des Cortex bzw. andere beteiligte Systeme des Gehirns, bei der Empfindung insbesondere ins limbische System, Amygdala und Thalamus. Rationales Bewußtsein sollte mithin im Feuern der letzten an der Endauswertung beteiligten Neuronen-Schichten und Systeme bestehen, das Bewußtsein von Empfindung und deren Intensität hingegen im Feuern der an der emotionalen Auswertung beteiligten Schichten und Systeme.(9) Instinkt erlaubt in seiner Festverdrahtung zwischen Sensorik und Reaktion das genetische Erlernen von Verhaltensmustern über die Art, hingegen gestattet die Steuerung des einzelnen Lebewesens über den Abgriff der zu- und abnehmenden hormonalen Konzentrationen die individuelle Lernfähigkeit und damit ein subjektives Empfinden. Lernen selbst als eine individuelle Form der Speicherung besteht in der mehr oder weniger lang anhaltenden neuronalen Abspeicherung von Impulsmustern mittels Synapsenverstärkung im zugehörigen corticalen Feld. Die Interpretation dessen, was schließlich das jeweilige Bewußtsein "wahrnimmt", setzt sich immer zusammen aus dem aktuellen Sinnessignal mit der "entgegenkommenden Erinnerung", die durch einen vorbewußten Vergleich aufgerufen wird; ohne dieses Entgegenkommen und Vermischen fände kein Tier seine Nahrung, könnte der Mensch sich in seiner komplexen Umwelt nicht bewegen noch einen einzigen Buchstaben lesen.(10) Wenn nicht alles täuscht, ist an diesem rückgekoppelten Vergleich insbesondere der Thalamus beteiligt, der mit allen bedeutenden Wahrnehmungsfeldern verbunden ist. Die einzelnen Sinne wie auch der Körper und seine Organe selbst und ihre entsprechenden Repräsentationsfelder sind hier offenbar mit dem emotionalen System vernetzt; das Wiedererkennen eines Sinnessignales durch Vergleich mit dem zugehörigen Engramm ruft die entsprechende und konditionierte Bewertung dieses Ereignisses mit auf und gibt beim aktuellen Erreichen des "Grenzwertes" die entsprechende Gesamtreaktion frei. Was aber sind "Sinnessignale" auf der Ebene der Emotio? Es sind die Eigenschaften der Dinge, die vom jeweils zugehörigen Sinn erfaßt werden, und die entsprechende Empfindung auslösen. So gesehen ist auch noch jedes Bild eines Dinges auf empfindender Ebene nichts anderes als eine Eigenschaft von Dingen. Es sind Formen, Farben und Bewegungen von Dingen, die auf tierischer Ebene vom Sehsinn gespeichert und wiedererkannt werden, nicht aber die Dinge selbst. Auf diese Weise wird mittels Empfindung eine horizontal-additive Konditionierung verschiedener Sinnessignale möglich.(11) Die Dinge in unserem menschlichen Sinne kristallieren sich erst heraus als eine vertikal-integrierende Eigenleistung des Verstandes: in der Verbindung der verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Sinnesergebnisse zu einem Wirkungsträger. Diese Zusammenfassung wird mit einem eigenen Begriff belegt, in einem eigenen Gehirnbereich repräsentiert und vom Verstand selbst bewertet (zunächst unter Anleitung der Emotio). Grammatik ist das Zueinanderstellen der Begriffe und damit die Bemächtigung von Welt mittels Sprache als Verstand.(12) Lassen Sie mich es im Bild sagen: Worte sind die Fackeln, in deren Licht uns erst die Dinge erscheinen. An dieser Nahtstelle tritt auch dasjenige hervor, was der Mensch als sein "Ich" bezeichnet: die Fähigkeit des Verstandes, Dinge als Wirkungsträger zu identifizieren, führt per se ipsum dazu, auch sich selbst, die eigene Person als Wirkungsträger und Handlungsmittelpunkt zu erkennen und unter einem eigenen Begriff zusammenzufassen: das "Ich" als Träger und "Inhaber" der Selbstwahrnehmung einschließlich des Fühlens wie der Datenspeicherungen des Verstandes. Daher sollte denn auch die nochmals erhebliche Zunahme der Gehirnmasse des homo sapiens sowohl gegenüber den Primaten als auch gegenüber seinen eigenen Vorläufern (habilis und erectus) stammen; das Sprechen selbst (Broca- und Wernicke-Zentrum) und die eigenständigen Speicherungen von Verstand und Vernunft erfordern ihren eigenen Bereich. Aus dieser Verbindung von Emotio und Verstand geht dasjenige hervor, was wir Fühlen nennen: die Übertragung emotionaler Bewertungen nun nicht mehr an die Eigenschaften von Dingen, sondern auf die Dinge selbst. Das sich durch den Verstand als Fiktion herausbildende "Ich" bezieht die durch die Emotio vorbewerteten Empfindungen der Sinne wie der Organe auf diese "Zentrale" und erschafft so unsere Gefühle.(13) Dies ist der Unterschied zwischen dem Empfindungsbewußtsein von Tieren, die diesen Empfindungen direkt ausgesetzt sind, und dem Fühlen des Menschen, der seine Empfindungen in der Reflexion der Emotio immer auch durch den Verstand erfährt.(14) Ob und welchem Beurteilungszentrum – und damit auch Werte-Zentrum! – der Mensch folgt, hängt von seiner individuellen Vernetzung dieser Vermögen Emotio, Verstand und Vernunft ab, die zum Teil geschlechtsbedingt ist, und sich teils aus der Anlage, teils aus der umweltbedingten Epigenese des Gehirns ergibt. Tiere verfügen nicht über diese verstandesfingierte "Ich-Zentrale", und so macht es keinen Sinn, ihnen Gefühle zuzusprechen; andererseits sind sie der Selbstwahrnehmung von Grundempfindungen der Emotio direkt ausgesetzt, also neben der emotionalen Konditionierung der Sinneswahrnehmung vor allem auch den sich notwendig in diese Emotio einspeisenden Parametern der Selbstwahrnehmung: die lebenswichtigen Signale des Gesamtorganismus, um dessentwillen alle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung entsteht, müssen sich natürlich auch in den jeweils neu erstehenden Vermögenszentren geltend machen, und so werden diese Bedürfnisse als Grundempfindungen in das neue Zentrum "durchgeschleift". Hunger, Durst, Sexualtrieb, Schmerz und Lust aus der Herübernahme der instinktiven Notwendigkeiten, aber auch eigenständige Grundempfindungen der auf der Emotio basierenden Lebensorganisation bilden so den Bestand des Empfindungsbewußtseins bei Tieren; denn insbesondere die auf Basis der Emotio möglich gewordene individuelle Kommunikation und Sozialisation einschließlich der ab diesem Stadium möglich gewordenen Tradition von Verhaltensweisen führen zur Ausbildung von gegenüber dem Instinkt eigenständigen Empfindungen. Dazu zählen alle Empfindungen, die für den Bestand einer funktionierenden Herdenorganisation zu erwarten sind: eine Empfindung der Zugehörigkeit(15) und des Ranges, von "Mut" und "Furcht" (im Hinblick auf Herdenverteidigung und männliche Rivalität), aber auch Vorformen von Scham, Freude und Verlustempfindungen. Diese sich aus der tierischen Sozialisiation ergebenden Empfindungen sind es, die häufig mit den menschlichen Gefühlen verwechselt werden, deren Basis sie sind. Diese Empfindungen bilden die Grundlage der Kooperation ebenso wie der Täuschung, verbunden mit der Fähigkeit zu Empathie und Sympathie: die Fähigkeit zur Nachempfindung und daraus folgender Mitempfindung.(16) Von daher macht es sehr wohl Sinn, zwischen "Ich" und "Selbst" zu unterscheiden, wie wir dies für uns selbst als Menschen denn ja auch ganz spontan tun: das je eigene "Selbst" umfaßt einen wesentlich größeren Bereich als das sich als steuernd denkende "Ich" – das "Ich" weiß, daß es aus einem rationalen "Selbst"-Verständnis stammt, und daß neben dieser Rationalität noch ganz andere Quellen der Selbstwahrnehmung wirken, die sich zwar in der Rationalität spiegeln, aber nicht aus dieser stammen. Es legt sich also quasi von selbst nahe, das Selbst mit der Empfindung und das Ich mit der Ratio zu verbinden.(17) An dieser Stelle noch ein Wort zur so oft beschworenen "weiblichen Intuition": es ist inzwischen allgemein anerkannte Tatsache, daß sich die körperliche Ausprägung von Mann und Frau nicht gleichen, und eben dies gilt auch für das Gehirn; in seiner embryonalen und epigenetischen Entwicklung wirken genetisch gesteuert andere hormonale Einflüße auf das Gehirn der Frau ein (Östrogene) als beim Mann (Testosteron) und führen so zu einer unterschiedlichen Vernetzung. Insbesondere ist das Corpus callosum, die Verbindung der rechten und linken Gehirnhälfte, beim weiblichen Geschlecht wesentlich stärker ausgeprägt, sodaß zwischen beiden Hälften ein wesentlich stärkerer Austausch stattfindet. Das bedeutet aber gleichzeitig, daß die emotionalen Bestandteile des Bewußtseins sich wesentlich wirksamer geltend machen können als beim Mann, bei dem rationales und emotionales Bewußtsein einer stärkeren Trennung unterliegen. Und so fließt der vorrationale Entscheidungsprozeß der Emotio in die sich rational kristallisierenden Handlungen als "weibliche Intuition" mit ein. In der Übertragung der im Tierreich erworbenen Empfindungen an die Dinge der Welt (einschließlich seiner selbst) differenziert der Mensch seine reiche Gefühlswelt aus; alle Antinomien unseres Verstandes wie unserer Vernunft bis hin zu unserer Einteilung der Welt in Gut und Böse, Nützlich und Schädlich, Schön und Häßlich entstammen der Skalierung der Emotio: der Anstieg unangenehmer sowie der Abfall angenehmer Konzentrationen wird als negativ bewertet und umgekehrt. Daraus wird auch klar, warum das "Schöne" des Verstandes bei verschiedenen Völkern so unterschiedlich ausfallen kann; ist seine Konditionierung doch abhängig von den entsprechenden Umwelterfahrungen, also vom konkreten Lebensraum und dessen Bedingungen, die überwiegend die Lebensverhältnisse bestimmen: Klima, Fauna und Flora, und schließlich die eigene menschliche Zivilisation, die unter diesen Voraussetzungen entstand. Unser stärkstes Gefühl, die Liebe, gründet zunächst auf der genetischen Verwiesenheit des Instinkts, von wo aus sie sich mit der Emotio in Anziehung von angenehmen und damit reizenden Eigenschaften verwandelt; der Verstand will diejenigen Dinge haben, die ihm als angenehm bzw. nützlich erscheinen, die Vernunft wiederum ersehnt einen Zustand, der ihr als "gut" erscheint. Die Maxima dessen, was Emotio und erwachender Verstand als angenehm und nützlich erfahren, ziehen den Menschen am stärksten an. Entstammen diese Dinge zunächst alle der Natur, verlagert sich diese Anziehung mit der durch Seßhaftwerdung und Arbeitsteilung zunehmenden Zivilisation auf selbstgeschaffene Gegenstände der Kultur. Der Inhaber solcher anziehenden und damit schönen Dinge erlangt durch diesen Besitz selbst Bedeutung – Macht und Schönheit gehen hier ihren bis heute anhaltenden Bund ein. Und was der Mensch aus Liebe zum Angenehmen, Nützlichen und schließlich zum Idealen und Heiligen hervorgebracht hat, macht seine Welt erst lebenswert. II. Die Herkunft des "Schönen" So, wie die Vernunft vom Wesen der Dinge auf das Ideal schließt, ebenso der Verstand vom Nützlichen auf das Schöne. So, wie dem Mythos des Verstandes die Metaphysik der Vernunft entspricht, und dessen Moralen die Ethik der Vernunft, geradeso verhalten sich zueinander das Ideale der Vernunft und das Schöne des Verstandes. Damit wird sofort klar, daß ich weder die Kant-Schopenhauersche Auffassung vom "interesselosen Wohlgefallen" beim Anschauen des Schönen noch die metaphysische Begriffsbestimmung des Schönen teile, die sich aus der Übereinstimmung von "Schein und Wesen" ergeben soll. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist, daß sich das Wesen der Schönheit vor allem aus evolutionären Gesichtspunkten ergeben muß; denn jeder andere Frageansatz würde von vornherein unhinterfragbare Metaphysik voraussetzen und die Schönheit anthropozentrisch verklären anstatt sie empirisch zu erklären. "Kunst" wickelt sich in der Rezeption des jeweiligen Vermögens aus und erreicht ihren Höhepunkt im Umschlag zur eigenen Reflexion: das jeweilige Vermögen bringt damit sich selbst zunächst unbewußt die Maxima seiner Wert-Schätzung in die Welt. Für den Verstand ist dies das für die Sinne überwältigend Über-Waltende (von den Höhlenmalereien bis zu den Pyramiden), für die Vernunft das Wesens-Optimum des Idealen (von Kunst und Ethos der Griechen bis hin zum "Erhabenen" Kant‘s). Eine erste mögliche Begriffsverwirrung ist insoweit auszuräumen, als die meisten Theoretiker des Schönen ihre Lehre "Ästhetik" benennen. Diese Verwendung schränkt den griechischen Begriff der aisthesis auf eine Teilbedeutung als "Feingefühl" ein; das ursprüngliche Spektrum des Wortes ist jedoch wesentlich umfassender und reicht von Empfindung über Gefühl und Sinn zu Erkenntnis, Verständnis und Bewußtsein, deckt sich also mit demjenigen, was hier als Verstandesvermögen bezeichnet wird.(18) Die aisthesis benennt mithin jenes Vermögen, das die Dingwelt unter eigenständiger Speicherung der benennenden Begriffe aus dem Meer der verschiedenen Eigenschaften mittels deren Rückführung auf einen Wirkungsträger erst "hervortauchen"(5) läßt. Im hergebrachten Begriff der Ästhetik spricht sich jedenfalls die richtige Beobachtung aus, daß das Schöne empfunden werde, wobei das Individuum in diesem Fall von seinen Emotionen geleitet wird; eine Reflexion dieser Empfindungen mittels Vernunft findet nicht statt, und der Verstand nimmt dabei nur die Aufgabe des dienenden Verstehens wahr. Im Normalfall wird auf diese Weise der Empfindung des Schönen eine apriorische Unhinterfragbarkeit unterschoben. "Was Schönheit sey, weiß ich nit", bekannte schon – ... Albrecht Dürer! Wenn im folgenden öfter von einer Empfindung des Schönen die Rede ist, so deshalb, um den Anschluß an den herkömmlichen Sprachgebrauch zu wahren, der mit der "Empfindung des Schönen" auf die eigentliche Unbewußtheit der zugrundeliegenden Urteilskriterien verweist. Zu lesen ist hier immer "Fühlen", denn diejenigen menschlichen Empfindungen, an denen der Verstand ursächlich mittels eigener Interpretation beteiligt ist, vollziehen sich im Unterschied zum Tier immer als Gefühl. Gefühle entstehen also aus dem aktiven Zusammenwirken des Verstandes mit der Emotio. Anderes gilt für rein körperliche Empfindungen, an denen der Verstand quasi nur als Beobachter teilnimmt, wie etwa Schmerz oder Lust: hier handelt es sich um eigenständige Empfindungen der Emotio. Zu einer ausschließlich ästhetischen Begriffsbestimmung der Empfindung des Schönen steht im Gegensatz, daß es auch in Bereichen der Vernunft sowie in Bezug auf die Transzendenz(19), also im rationalen(20), ethischen und numinosen Bereich, eine Form der Schönheit gibt, die mit einem solch emotional bestimmten Begriff "Ästhetik" überhaupt nicht erfaßt werden kann. Der rein ästhetische Typ, der alle wichtigen Entscheidungen über die Emotio fällt – was gerne auch als "Sensibilität" bezeichnet wird – ist sehr selten, vielmehr besteht die Menschheit in der Hauptsache aus Mischtypen zwischen Emotio, Verstand und Vernunft, die sich auf eine individuell variierende Anzahl von emotionalen und rationalen Leitwerten konzentriert haben. Dieser Mischzustand wird bei der Beurteilung des Schönen selbst noch in der einzelnen Brust Verwirrung stiften, da sich die emotionale Empfindung des Schönen und die rational oder ethisch als "schön" geforderte Bewertung häufig widerstreiten. Wird von einer sensiblen Natur der Mord am Helden im Drama womöglich als entsetzlich empfunden, vor allem vom weiblichen Geschlecht, so stellt der Verstand eine Kosten-Nutzen-Rechnung an, ob wenigstens das Ergebnis dem Einsatz entspricht; für den Ethiker hingegen steht mit eben diesem Tod der Held unwiderruflich auf dem Gipfel von Ruhm, Ehre und Würde. Diese ethische Bewertung läßt sich dann durchaus als "schön" ansprechen, meint aber etwas völlig anderes als die ästhetische Bewertung. Anders gefragt: wer würde wohl die vielen bluttriefenden Kreuzigungsdarstellungen als "schön" bezeichnen, bei wem lösen die Bilder aufgeschlitzter Märtyrer ästhetisches Wohlgefallen aus? Wie nicht anders zu erwarten, begann diese Vermischung und Verwirrung hinsichtlich des Schönheitsbegriffes sofort mit dem Hervortreten der Rezeption der Vernunft bei den Griechen. Diese Entwicklung setzte etwa mit dem 8. Jh. vC (Naturphilosophie) ein und kristallisierte sich schließlich im 6./5. Jh. vC zum Lebensideal der "Kalokagathie", zusammengesetzt aus kalòs k(aì) agathós(21): das ästhetische und das ethische Moment werden zusammengesetzt, und die Verwirklichung beider Kategorien zum Lebensideal erkoren. Daraus ist als erstes die Frage abzuleiten: was wird eigentlich aus dem Schönen im Aufstieg zur Vernunft? Hat es als solches dort beziehungsweise in Verbindung mit dem Numinosen/der Transzendenz überhaupt Platz, und wenn ja: Was denn am Schönen gelangt in die jeweils höhere Kategorie, was wird auf diesem Wege ausgeschieden? Und: welche Kriterien müssen erfüllt werden, damit in diesen Kategorien etwas "schön" genannt wird? Bevor wir hier "hinauf"steigen, muß zunächst geklärt werden, oder doch zumindest der Versuch dazu unternommen werden, was denn Schönheit in der Verstandeskategorie überhaupt sei – woher ist sie uns Menschen gegeben worden und wozu? Wir haben also zunächst hinabzusteigen. Erste These: In der Natur existiert keine Schönheit ohne den anschauenden Menschen. Die "Schönheit" liegt nicht in den Dingen, sondern sie ist eine Interpretation des die Außenwelt mittels Verstand erschließenden Bewußtseins des Menschen, der damit zuallererst die Dinge ent-deckt. Zu diesem Zweck werden die Dinge der Welt zunächst mit der Emotio bewertet und in deren Gegensätze von angenehm/unangenehm geschieden, auf denen wiederum die Verstandesscheidungen von nützlich/schädlich beruhen. Wir haben somit zwei Dinge zu untersuchen: was speziell an den Dingen ist es, das wir als "schön" interpretieren; und wie und wodurch kommen wir überhaupt dazu, eine solche Interpretation und Empfindung auszubilden? Daß wir das eine Ding als schön bezeichnen, ein anderes aber nicht, gründet in der Ausdifferenzierung dieser Dinge durch die Natur selbst, die jene Unterschiede schon vor jeglichem anschauenden Bewußtsein und somit zu ganz anderen Zwecken geschaffen hat: sie gestaltet damit die Beziehungen zwischen den Lebewesen pflanzlicher und tierischer Art, sei es innerhalb einer Spezies, sei es artübergreifend. Die Interaktion setzt die Auffälligkeit des Beziehungssignals voraus, durch welches diese Interaktion vermittelt werden soll. Dies ist das allererste Kriterium der "Schönheit", wie wir Menschen sie dann in ausdifferenzierter Weise in der Natur vorfanden. Die Natur macht sich alle sensorischen Fähigkeiten der verschiedenen Lebewesen zunutze in Wechselwirkung zwischen Beziehungssignalen und Sinnesorganen, welche unter den jeweiligen Umständen eine bestimmte Signalart begünstigen. Hier mögen stellvertretend stehen die Variationen von Form und Farben der Blüten, welche die Insekten zur Bestäubung "verleiten". Von daher ist die Natur voll von Auffälligkeiten – sie ist Differenzierung. Diese vollzog sich ebenso evolutionär und utilitaristisch, also im Hinblick auf einen ganz bestimmten Zweck in der Interaktion, wie sie sich der Mensch als letztes Glied dieser Kette zunutze machte. Denn er bezog diese zunächst gar nicht für ihn "gemachten" Auffälligkeiten auf sich selbst und bewertete sie dabei mittels seines aus dem Tierriech hergebrachten Empfindungsvermögens. Diese Bewertung gilt in der Rezeption des Verstandes aber nun nicht den Eigenschaften von Dingen, sondern die Dinge selbst werden in der Ausbildung des Verstandes festgestellt und bewußt, und mittels Emotio in angenehm/nützlich und unangenehm/schädlich eingeteilt. In diesem Entwicklungsstadium sind wir noch weit entfernt davon, daß man bereits von einer Erfahrung von Schönheit im Sinne der Verstandeskategorie als einer verselbständigten Empfindung sprechen könnte. Vielmehr beschränkt sich diese neue Erfahrungsmöglichkeit der Dinge zunächst auf die Verbindung des Auffälligen mit dem Angenehmen und Nützlichen. Der Mensch macht sich zunächst rezipierend diese Fähigkeit des Differenzierens und Zuordnens durch Auffälligkeiten, welche er der Natur unbewußt abschaut, selbst zunutze. Dazu zählen etwa die Kenn-Zeichnung von Gegenständen, oder die Kenn-Zeichnung der Gruppe und der Mitglieder innerhalb der Gruppe, um die Zusammengehörigkeit beziehungsweise die Rangordnung sichtbar zu machen. Auf all jene idyllisch-romantisierenden Versuche einer "Nachempfindung" der "Schönheit von Natur" und der Geborgenheit in ihr, wie sie etwa ein J.-J. Rousseau mit seinen "edlen Wilden" propagierte, konnte der frühe Mensch gar nicht kommen, weil ihm die Reflexion dazu fehlte. Er war von Haus aus in der Natur geborgen, der Bezug zur Natur war für ihn einfach und direkt. Tier war er zwar nicht mehr, als er mit dem Verstand die emotionale Verwiesenheit auf die Gegenwart von Eigenschaften der Dinge im Medium der Zeit als Dauer im Nach- und Nebeneinander der Dinge selbst überwunden hatte; Mensch in unserem Sinne aber war er noch nicht, insofern er den Wirkungen der Natur unreflektiert und direkt ausgesetzt war. Zu einem abgezogenen Begriff des Schönen kann es erst mit der Kunst kommen, wenn künstlich/handwerklich-selbstgeschaffene, der Natur nachgeahmte beziehungsweise sie versinnbildlichende Gegenstände dieser gegenübergestellt werden. Solche kulturellen Artefakte entstehen zunächst aber – neben der oben genannten Zugehörigkeitsbezeichnung von Gebrauchsgegenständen, wie etwa die Becher- und Krugformen beziehungsweise deren "Schmuckmuster" – aus numinosen Motiven, die wohl am gemeinsamen Ursprungspunkt von Kunst und Religion stehen. Mit der vom Verstand erkannten und diesen Verstand allzuhäufig überwältigenden Ausgesetztheit (Ek-Sistenz) galt es sich ins Benehmen zu setzen. Die Erfahrung der Überwältigung, die mit dem erwachenden Verstand auf die Wirkung von Dingen zurückgeführt werden konnte und mußte, wurde gebunden und eingebunden ins Leben, indem man ihr einen gesonderten Bereich zuordnete. So brachte man diese Erfahrung einerseits aus dem alltäglichen Leben heraus, d.h. man blieb handlungsfähig; andererseits behielt man diesem Erfahrungsbereich besondere Bezirke vor, heilige Orte und geweihte Stellen, an welchen sich dies Grauen in besonderer Weise kundtat – kundtat vor allem den dafür "Begabten", das heißt in der Regel denjenigen, welche durch Veranlagung mit der Offenheit ihrer verstandesmäßigen Rezeption an der Phylogenesespitze standen. Um jene Bereiche – meist Höhen und Haine, aber auch Moore und Höhlen, wo es dem Menschen un-heimlich ist – von den profanen abzuscheiden, mußten sie in besonderer Weise be-zeichnet werden, und dies im doppelten Wortsinne als Begriff und als Akt. Die direkt-sinnliche Eingebundenheit wirkt sicherlich zunächst dahin, daß die Erfahrungen jener überwältigenden "Kräfte" im verstandesmäßigen Erleben des Ausgesetztseins als Dämonen und Naturgottheiten immanent symbolisiert wurden. Damit konnten sie in und mit der Anschauung als sinnliche Gegenstände festgestellt werden, um sie umgänglich zu machen oder zu bannen. So geben uns die Fels- und Höhlenmalereien aus den frühesten Zeiten ein Bild dieser doppelten Bezeichnung, auch wenn wir diese Kultvorstellungen nicht mehr nachvollziehen können – und mit eben solchen Be-Zeichnungen im wahrsten Sinne des Wortes scheint die Kunst und damit die Geschichte der Empfindung von Schönheit begonnen zu haben.(22) Es liegt auf der Hand, denn es deckt sich mit der piktografischen Wahrnehmungsweise und Abstraktion unserer Sinnesorgane selbst(23), daß diese bezeichnende Darstellungsweise ohne Reflexion nur typisieren konnte. Die direkte Anschauung und Nachahmung des Natürlichen wählt geradeso wie die Natur in den Beziehungssignalen das Auffällige aus, das "Vorspringende". Das Wiedererkennungsmuster ist die notwendige Grundlage der sinnlichen Wahrnehmung, das heißt, der Gegenstand wird in der Darstellung geradeso wie in der Wahrnehmung auf sein Sinn-Fälliges, in die Sinne Fallendes verkürzt. Mit dieser Fähigkeit zur bezeichnenden Darstellung ist zwar in den Menschen immer noch nicht das Gefühl des Schönen vorhanden, aber ihr Ursprungsgrund: die für jedermann sichtbare Differenz zwischen dem natürlichen Gegenstand und seiner typisierten Darstellung. Der Prozeß des Seßhaft-Werdens, der Ausbildung von Machtzentren mit all seinen zivilisatorischen Folgen, insbesondere der Spezialisierung durch Arbeitsteilung samt der weiteren Ausdifferenzierung der Rangordnung innerhalb der Spezies Mensch, profaniert auch diese bezeichnende Darstellung. Zunächst geschieht dies wohl in einer "einfachen" und direkten Ableitung, als der oder die Herrschenden in Nachahmung der göttlichen Geweihtheit sich ihres Herausgestelltseins durch "Bezeichnung" versichern. Die äußerlichen Zeichen der Würde sind denn ja auch heute noch sehr gefragt...(24) Jene durch die Seßhaftigkeit sich auf der Basis der Rezeption des Verstandes wechselwirksam steigernden kulturellen Fähigkeiten und Bedürfnisse bringen das Handwerk und dessen Spezialisierung hervor, was gleichzeitig auch der Darstellungsfähigkeit im Dienste von Gottheiten und Machthabern zugute kommt. Die be-zeichnende Nachahmung der sichtbaren Gegenstände bleibt zwar immer noch direkt, aber sie nähert sich ihrem Objekt immer mehr an und wird in der Reflexion des Verstandes schließlich naturgetreu – man sehe etwa die hervorragende Nachbildung von Katzen durch die Ägypter. Diese neue "Kunstfertigkeit" bringt damit ein neues Differenzbewußtsein in die Köpfe der Menschen: daß es innerhalb der durch das "Kunsthandwerk" geschaffenen Gegenstände Unterschiede in der Qualität der Darstellung gebe, und daß das naturgetreue Abbild einer typisierenden Annäherung vorzuziehen sei. Warum? Dies sollte sich durchaus evolutionär erklären: die naturgetreue Darstellung erringt mehr Aufsehen und trägt damit mehr Ansehen ein, sei es der Gottheit, sei es den Mächtigen. Damit hat die Empfindung der Schönheit als ein emotionales Differenzbewußtsein, das über die Qualität einer künstlich gefertigten Darstellung mittels sinnlicher Wahrnehmung und sinnlichen Vergleichens ein Urteil fällt, Einzug in die Menschheit gehalten. Nicht zwar als die Empfindung des Schönen an sich, aber in Gestalt eines komparativischen Urteils über den Vergleich von Vorstellungen des Verstandes mittels Emotio: etwas sei mehr oder weniger schön. "Schön" steht hier also noch für eine Überwältigung der sinnlichen Erfahrung in nicht für möglich gehaltener Weise etwa durch die Naturtreue einer Darstellung, deren kultischen Ausdruck bzw. mittels schierer Größe, etwa durch Menschenhand zugleich geschaffene und gebändigte Bauwerke. Zweite These: das Bewußtsein von Schönheit als die verselbständigte Empfindung des Schönen an sich ist ein Ergebnis der Rezeption der Vernunft. Der Endpunkt der verstandesgemäßen Auswicklung von "Schönheit" ist erreicht, wenn nach der Ausschöpfung der aktiven Potenz des Verstandes mit der sich steigernden Qualität des Handwerks die naturgetreue Darstellung möglich geworden ist beziehungsweise typisierte und nunmehr gültige Muster festgestellt worden sind. Diese drücken ganz offenbar das Maximum der Aussagefähigkeit dieser Kulturstufe aus und werden nurmehr tradiert, ohne verbessert werden zu können (siehe wiederum die Kunst der Ägypter). Das "Ideal" des Verstandes als Schönheit ist damit erreicht. Zur Weiterentwicklung dieser Stagnation war dann ein Neues gefordert: die Anlage zur Rezeption der Vernunft sowie deren Begünstigung durch die Kreuzung der alten Hochkulturen. Die abendländische Kultur und Kunst als eine Kultur der Vernunft beginnt mit der Einwanderung der griechischen Stämme und deren Niederlassung in Vorderasien. Von dort aus, im strategisch wichtigen Einzugsgebiet für die jeweils herrschende Großmacht sitzend, machten jene notwendig Bekanntschaft mit all den vor ihnen selbst liegenden Kulturen – der lydischen, babylonischen und persischen wie auch der phönizischen, kretischen und ägyptischen. So entstehen zunächst in Kleinasien übergreifend auf das alte Hellas nicht zufällig die Philosophie und die "neue Kunst" gleichzeitig: die eigenständige Rezeption der Verstandesdaten in Wechselwirkung mit der Kreuzung aller Kenntnisse der Zeit erlaubt den entscheidenden Schritt zur Vernunft, von der Beobachtung des Typischen auf das darunterliegende Wesentliche zu schließen. Es wird erkannt, daß eine bestimmte äußere Eigenschaft, ein besonderes Merkmal, auf eine besondere und wesentliche Aufgabe zurückzuführen ist, und daß diese besondere Wesensart in ihrer Funktion und Gestaltung in sich selbst unterschiedlich ausgestattet sein kann, sowie, daß nicht jede Ausstattung einer wesentlichen Anlage für die damit zu erfüllende Aufgabe gleich gut geeignet sei. Denn die sich eröffnende Vernunft vermag nicht nur, wie der Verstand, das Außen direkt zu erfassen und entlang an dessen Typischem zu begreifen, sondern auf dem sich vertikal zum Verstand öffnenden Bewußteinsspiegel der Vernunft können die wesentlichen Eigenschaften der Dinge isoliert und verglichen werden. Diese Wandlung des Sehens hin zum dialektischen Vergleichen führt in der Kunst zu einem neuen Maßstab des Schönen, oder vielmehr überhaupt erst zum "Schönen an sich". Einerseits wird das Typisierende, das Stereotype, das vordergründig Absichtsvolle und Hergebrachte überhaupt verworfen, und damit die Darstellungsfähigkeit von "kunstfremden" Fesseln befreit. Andrerseits erkennt man, daß die Naturtreue zwar notwendige, aber nicht alleinige Bedingung des Schönen ist, sondern daß vielmehr noch hinzuzutreten haben die Richtigkeit und Geeignetheit. Das bedeutet erstens, daß an die Stelle des Typisierens die Darstellung der Individualität des Menschen tritt; und es bedeutet zweitens, daß diese Individualität zur Idealität gesteigert wird: die Abstraktionsfähigkeit des Künstlers sondert in der Darstellung alles Zufällige ab und konzentriert sich bewußt und im Gegensatz zur unbewußten Abstraktion von Sinnesorganen und Verstand auf das Wesentliche, das Allgemein-Gültige (was parallel ideengeschichtlich über die Dialektik zur Ethik hinführt – dies der Zusammenhang zur Philosophie)(25). Der Ideal-Typus muß vom Künstler zusammengesetzt werden, indem er an lebenden Mitmenschen den jeweils "schönsten" Teil wie Leib, Gesicht oder Haltung studiert; das Kriterium des "Schönen" seitens des Künstlers bildet die "Richtigkeit", welche aus der Naturtreue und Geeignetheit hervorgeht, dies ist das eigentlich Neue: am "schönsten" ist derjenige Leib oder dessen Teil, der am besten zu der ihm gestellten Aufgabe dient; am "schönsten" ist ein Gesicht, das die Menschen zu seinem Träger hinzieht – und auch hier am Grunde der Kunst immer noch die Evolution und ihr selektierender Utilitarismus! Ein solch zusammengesetzter Idealtypus ist dann zwar naturgetreu in seinen Einzelheiten, stellt aber insgesamt eine höhere Wahrheit dar, als sie die Natur gemeinhin hervorbringt. Nun sind derartig handwerklich-künstlerische und gleichzeitig reflexive Fähigkeiten zur Erschaffung solcher Kunstwerke damals wie heute immer nur sehr wenigen Individuen einer Generation gegeben. Das durchschnittliche Schönheitsempfinden sowie auch dessen "Undeutlichkeit" geht aus der Rückwirkung hervor: solche idealtypischen Kunstwerke erregen die Bewunderung der Menschen in ähnlicher, aber in qualitativ neuer Weise gegenüber dem vorherigen Bestaunen beziehungsweise Beeindruckt-Werden, weil sie hier die eigene Art in der Überhöhung zu Gesicht bekommen. Die dabei empfundene Differenz zwischen dargestellter Idealität und der beobachtbaren Wirklichkeit hält rückwirkend Einzug in das Empfinden des eigentlich unreflektierten Normal-Menschen. Ohne zu wissen, wie oder warum, fühlt sich seine Emotio von der überhöhten Möglichkeit dieses Idealtypus überwältigt – und damit hat sich die eigentliche "Empfindung des Schönen" innerhalb der Menschheit etabliert. Harmonie Eine Grundeinheit der Schönheit ist die Proportionalität, welche der Mensch seiner natürlichen Anschauung entnimmt, indem er sich selbst und seine Maße in die Natur hineinprojeziert. Betrachtet man die Gesamtgestalt des Menschen beziehungsweise die Verhältnisse seiner Gliedmaßen und Gesichtsbildung untereinander, so ist hier im Rahmen einer bestimmten Bandbreite ein spezifisches Verhältnis zwischen den Längen und Breiten sowie den Längen untereinander gegeben, welche Bandbreite wir unbewußt "erkennen", weil unsere Wahrnehmung durch diese Verhältnisse bereits unbewußt geprägt ist. Was diese Bandbreite überschreitet, gilt als anomal; wo sie besonders gut getroffen ist, gilt dies als "schön". So haben die Beine im Verhältnis zur Gesamtlänge ein "schickliches" Verhältnis zu haben, Kopflänge, -breite und -tiefe sollten sich ebenfalls in bestimmter Weise entsprechen – nach Leonardo da Vinci gibt der Goldene Schnitt diese "schönheitsbildende" Proportion in etwa an. Wie bei der Darstellung des menschlichen Körpers spielt die Proportionalität eine wichtige Rolle in der Baukunst, vor allem zunächst natürlich bei den Tempeln der Götter. Ursprünglich entstanden aus den numinosen Erfahrungen in Hainen (die wohl zu Säulenhallen werden) und Bergeshöhen (daher die Tempelgründungen auf Erhöhungen) mußten die Gebäude neben der reinen Tauglichkeit zunächst vor allem die Sinne beeindrucken. Daher suchten sich die Bauherren der Verstandeskultur durch die Größe der Bauwerke zu übertreffen.(26) Gleichzeitig mußte jedoch die schiere Größe durch Maß und Form gebändigt werden, um die Harmonie der Einzelteile zu erreichen: diese Bauwerke verkörpern immer gleichzeitig auch einen Symbolgehalt und müssen daher eine Einheit ausdrücken. Bei den Griechen kommt nun durch die die Verstandesdaten reflektierende Vernunftrezeption neu hinzu, daß sie auf die Subjektivität des Betrachters Rücksicht nahmen und um der Wirkung willen ihre Tempel perspektivisch erbauten; also nicht gerade und Stein auf Stein, sondern durch Neigung die Fluchtpunkte der Perspektive berücksichtigend, und so die Wirkung der Gebäude hervorhebend. Sinn und Ziel der Proportionalität ist die Harmonie; mit ihr wird die richtige Zuordnung der Einzelteile bezeichnet, welche in der Empfindung den Eindruck der "abgerundeten Ganzheit" erweckt. Damit läßt sich ihr Wesen aber schon klären: sie ist insoweit etwas Neues, als der Mensch mittels seiner Reflexion diese Harmonie selbst und bewußt herzustellen sucht. Dies setzt jedoch die Fähigkeit zur Wahrnehmung des "Unrichtigen" beziehungsweise von Disharmonie in der Realität mittels ebenderselben Reflexion voraus. Die Harmonie muß des weiteren, um die Forderung nach "idealer Ganzheit" einzulösen, das Urteil von Richtigkeit und Geeignetheit in der subjektiven Anschauung des Betrachters auslösen. Diese Kriterien müssen daher vom Künstler vorweggenommen werden. Je weiter jedoch ein Ding oder Wesen, das dargestellt werden soll, um sich greift, je mehr es in sich bezieht, desto schwieriger läßt sich die Forderung nach Harmonie erfüllen. Ist aber die "ideale Ganzheit" auch dann noch getroffen, wird die Wirkung eines solchen Werkes umso höher und stärker empfunden. Diese Harmonie kann in uns den Schein der Idealität erzeugen, denn durch die harmonische Zuordnung der Einzelteile eines Kunstwerkes entsteht für den Betrachter die Illusion des Heiles in einer die Realität übersteigenden Form, welche ihm die eigene subjektive Zerstreutheit nahebringt und ihn zu einer ähnlichen Bemühung für seine eigene Existenz zu spornen vermag: diese durch Konzentration zu einer Ganzheit zu runden. Die Reflexion der Verstandesergebnisse in der Rezeption der Vernunft führte somit dazu, daß die Richtigkeit eine notwendige Voraussetzung des Schönen wurde – in der Umkehrung konnte der Begriff Schönheit dadurch in die Ethik eindringen: daß, was richtig sei, auch schön sei – und damit wurden abstrakt-ethische Begriffe mit Empfindung aufgeladen. Schönheit und Transzendenz Die Beurteilung, daß etwas "schön" sei, kann mithin auf zweierlei Weise ausgelöst werden: entweder ruft ein Kunstwerk vermittelt durch den Verstand ästhetisch-unbewußt die Empfindung des Schönen hervor; oder die Beobachtung von Kunstwerken trifft beim Betrachter auf bereits vorhandene rationale, also bewußte Kunstmaßstäbe und wird von daher anerkennend beurteilt. Diese (oft vorgebliche) Rationalität wird zumindest in der bildenden Kunst meist emotional zurückgebunden sein: daß und was an einem Bild oder einer Statue "schön" sei, kann nicht rational begründet, sondern nur aus der Emotio in Verbindung mit der Traditionskonditionierung geschöpft werden – die Schönheit in der Verstandeskategorie und in den bildenden Künsten ist in ihrer Abhängigkeit von der Traditionskonditionierung immer relativ. Das zeigt die Beobachtung vom Schönheitsempfinden afrikanischer Stämme ebenso wie die schnell wechselnden und sich kreuzenden Moden in unseren doch so hoch entwickelten westlichen Kulturen. Anders Literatur, Musik und Theater (etwa die griechische Tragödie): diese setzen zwar eine ästhetische Form voraus, aber ihren eigentlichen Gehalt beziehen sie aus der reflektierenden Sehweise der Vernunft auf die Verstandesdaten; dabei verbindet sich die rationale Richtigkeit beziehungsweise Idealität mit der sublimierten Empfindung des "Angenehmen". Das lebendige Mitempfinden bestätigt das Selbst in der Erkenntnis der rationalen Richtigkeit, beziehungsweise führt es nach der Leitungsübernahme durch die Vernunft hin zur "ethischen Befriedigung" und damit ethischen Schönheit. Diese Auffassung von Kunst als die harmonische Verbindung des Ästhetischen mit dem Ethischen hat im deutschen Kulturraum wohl am stärksten Schiller in Werk und Theorie vertreten. Parallel zur Entwicklung des menschlichen Geistes entwickelt sich die Sublimation des Schönen; wie sieht diese Sublimation für die Transzendenz aus? Dabei ist im Auge zu behalten, daß der Ursprungspunkt von Kunst und Religion wohl der nämliche ist, und daß bereits in völlig unreflektierter Zeit religiöse Kunstwerke geschaffen wurden. Gegenstände, die wir Heutigen a posteriori als Kunstwerke bezeichnen, bei deren Herstellung a priori aber nicht das Ästhetische, sondern der feststellende Umgang mit dem Numinosen im Vordergrund stand. Läßt sich somit überhaupt etwas zur Sublimation des Schönen in Bezug auf die Transzendenz sagen, wenn man die bisherigen Beispiele des Transzendierens bis heute ins Auge faßt, wie sie uns Religions- und Geistesgeschichte tradieren? Nimmt man Werke wie etwa einige von Platon (Phaidon, Symposion), das NT, die Predigten Eckeharts, Schleiermachers "Reden über die Religion"; oder Shakespeare‘s "Hamlet", Goethes "Faust", Hölderlins "Hyperion", Nietzsches "Zarathustra"; oder Bach’s "Matthäuspassion", Haydn’s "Schöpfung", Mozart’s "Zauberflöte", Beethovens "Neunte", um nur einige zu nennen – und zwar nicht die Werke als solche, sondern was sie an lebendigem Geist auch für uns Heutige noch enthalten, so vermag dieser Geist in uns eine bestimmte Art von Empfindung auszulösen. Diese Empfindung sollte sich mit denjenigen Erfahrungen parallelisieren lassen, die einst den Menschen zuteil wurden, als sie die Verstandes- beziehungsweise die Vernunftkategorie als Neuland eroberten. Auch deren Rezeption war zum jeweiligen Zeitpunkt Transzendierung des Vorbestandes, die mit lebendiger Empfindung eben dessen bewertet wurde, was hier unter dem sublimierungsfähigen "Schönen" verstanden wird: das Individuum erlebt sich als über sich selbst hinaus erhoben, was sich funktional in konzentrierter Zustimmung über alle eigenen Vermögenszentren hinweg äußert. Dies Lebendige ist immer auch Teil des Schönen, und das Schöne ist immer Teil des Lebendigen. Lassen Sie es mich mit Hölderlin sagen: "O, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt, und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da, wie ein mißratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß, und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab."(27) Die Maxima dieser lebendig-inneren Erfahrung lassen sich beim Instinkt als sexuelle Ekstase, bei der Emotio als die Lust am Reizenden, beim Verstand als Machtrausch, bei der Vernunft als ethisches Pathos, und im Verhältnis zur Transzendenz als die Einung mit dem "Heiligen" bezeichnen. Soll folglich in Richtung auf Transzendenz etwas als "schön" gelten, so können zu dieser Wertung Momente aus den davorliegenden Kategorien als formale Voraussetzungen beitragen; denn geradeso wie die Ästhetik formale Voraussetzung von Schönheit in der Vernunftkategorie ist, so wird in Richtung auf Transzendenz jenes numinose Empfinden von der ideellen Begeisterung fundiert werden. Anders ausgedrückt: die Weise des Schönen muß auch den Ansprüchen von Verstand und Vernunft genügen, darf sich dazu nicht im Widerspruch befinden. Ausschlaggebend aber muß ein anderes sein: das Bewegt- und Hingerissen-Werden entstammt weder dem emotionalen Bereich des Angenehmen noch einem rational-ethischen Urteil des Richtig-Idealen, sondern aus dem nach wie vor lebendigen Geist und dem transzendenten Telos eines solchen Werkes – die Schönheit darin ist nicht objektivierbar und mitteilbar, sondern überträgt sich unmittelbar und existentiell. Sie muß von jedem Aufnehmenden in konzentrierter Eigen-Tätigkeit wiedererkannt werden, und im Kontakt mit dem Inneren des Werkes sich in ihm selbst erzeugen. Die Schönheit ist hier somit nichts Augenfälliges – wie übrigens schon in der Vernunft, wo das Erkennen des Richtigen die Anspannung des rationalen Urteils verlangt, und das Erkennen der Idealität gar ein lebendiges inneres Mitgehen und "Mitschwingen" voraussetzt – sondern im Gegenteil etwas Verborgenes, das sich erst nach dem Hintan-Lassen jener ersten beiden Kategorien, mithin in deren Transzendenz zu erkennen gibt, im lebendigen Kontakt zu einer überrationalen und überzeitlichen Wahrheit. Lebt andererseits der Mensch nicht in der Harmonie mit sich und dem Universum, fehlt ihm die geistige Gesamt- und Zusammenschau, so muß sich dies notwendig in der Kunst einer solchen Zeit in Form und Inhalt äußern. Eine Frage ist, wie und wodurch die in solcher Zeit geschaffenen Werke als Kunstwerke definiert werden können; denn bis zum Zeitpunkt der Auflösung des alten Kunstbegriffes setzte dieser die jeweils in Sicht und Darstellung erreichbare Harmonie als conditio sine qua non voraus. Wir erleben aber gerade die Auflösung dieser Harmonie, zwar nicht als eine "Disgregation der Instinkte", wie Nietzsche meinte, sondern als eine Disgregation der Gefühle: durch den rückwirkenden Fortschritt der Reflexion in die Masse wird deren vormals relativ einheitliches "Lebensgefühl" durch die Ratio aufgelöst, jeder propagiert sein eigenes Privatgefühl, der Zusammenhang und Zusammenhalt der Gesellschaft(en) auf ein Ziel hin zerfällt in tausend Gruppen und Grüppchen – so auch in der Kunst. Die "Stilrichtungen" vermehren sich explosionsartig; denn sieht man einmal von den rationalen und seriellen Techniken ab, bei welchen schon die Form den Inhalt machen soll, so steht überall im Vordergrund ein rational (etwa in Richtung auf Sinn und Ziel) nicht dingfest zu machendes Empfinden, dem in bildender Kunst, Musik und Literatur Ausdruck gegeben werden soll, und das in jedem Fall mit einer "neuartigen Expressivität" verbunden sein soll, weshalb denn diese "Kunst" eher zu Moden denn zu einem Stil führt. Letzterer wäre ja das Ergebnis von gereifter Kraft, wozu es aber gar nicht kommen kann, weil schnellwechselnd das Geschrei jeder Art von Talent die Aufmerksamkeit auf sich zieht, "Talent", das sich um jeden Preis durch das "Neue" auszeichnet; und dem ein "Publikum" entgegenkommt, das umso mehr auf diesen Reiz des Neuen angewiesen ist, je mehr es die Tradition verbraucht, weil Sinn, Ziel und Harmonie nicht zu sehen sind. Wie schon Musil richtig feststellte, findet man heutzutage das "Genie" in einem Tennisspieler oder gar in einem Pferd. Welche Deutung kann man dieser Zersplitterung geben? Die einer doppelten und gleichzeitigen Bewegung: die große Masse nimmt durch Industrialisierung, Verstädterung, Ausbildung und Medien an Rationalität soweit zu, daß sie zwischen Verstand und Vernunft zu stehen kommt. Diese Potenz, die Rezeptionsstufe der Vernunft ausschnittweise zu nutzen, ist offenbar in der Menschheit in großer Breite vorhanden, hingegen ist die Reflexionsstufe der Vernunft beziehungsweise gar darüberhinaus bereits selten. Anders die "Künstler" und die sie begleitende Gesellschaftsschicht; letztere wäre etwa so zu beschreiben: durchaus Misch-Typen zwischen Verstand und Vernunft wie die Masse auch, jedoch mit dem Schwerpunkt auf dem Selbstgebrauch der Ratio und dadurch größerer Unabhängigkeit von der Emotio. Diese haben die Ideen der vorlaufenden Philosophen, mit welchen letztere die Phänomene der eigenen Zeit interpretieren, eingeholt, jene "Ideen", die für unsere Zeit darin bestehen, daß sowohl die ethischen Ideale (Kierkegaard) als auch die Religion Illusionen seien (Schopenhauer, Nietzsche, Feuerbach); sodaß nunmehr den "sensiblen" Naturen, den aktiv oder passiv Sinnsuchenden, also den Künstlern und deren Publikum, eine positive Leitidee, wie sie vorher von der Religion beziehungsweise einer "optimistischen Weltanschauung" ausging (s. etwa auch das "sozialistische Kunstwerk" im Kommunismus!), abhanden gekommen ist. Im übrigen gibt es diesen Zusammenhang zwischen Kunst und Philosophie durchaus schon im alten Griechenland; die Ideen der Philosophen schaffen erst den Boden, auf welchem der Mensch von sich selbst ein neues Bild gewinnt; und dieses neue Bild wird zum Motor, der die griechische Kunst zu solcher Höhe führt, daß sie zum Vorbild des Abendlandes wurde. Siehe etwa in der Tragödie, wenn dort der Mensch mit den Göttern rechtet: darin äußert sich ein ganz neues Selbstbewußtsein der Menschen, das rückwirkend bis in den demos hineingelangt. Und wenn die bildenden Künste ihren ersten Höhepunkt erleben, so deshalb, weil die "ästhetischen" Künstler die Ideen von Philosophie und Wissenschaft (welche damals noch eines waren) und damit dieses neue Menschenbild aufgreifen: der Mensch wird zum autonomen Individuum, dessen Idealität in das Kunstwerk hineinverlegt wird, im olympischen Mythos verwischen die Grenzen zwischen Göttern und Menschen. Der Status von Masse und Künstlern sieht heute nur auf den ersten Blick so aus, als seien diese Auflösungerscheinungen eine Bewegung. Während die Masse entsprechend ihrer Übergangsstufe zwischen Gefühlen und ethischen Idealen schwankt, und letztlich nach wie vor immer das emotionale Fühlen den Ausschlag gibt, haben jene Künstler dieses ethische Ideal bereits verloren, ohne in Kunst und Existenz den Übergang darüberhinaus finden zu können. Vielmehr ist ihr Talent und ihr Streben gerade auf das Schaffen gerichtet, auf eine im Werk sichtbar werdende Interpretation von Mensch und Welt, wie sie sich ihnen darbietet. Darin liegt ihre Existenzerfüllung, und so müssen sie sich von diesem Punkt der zerstörten Ideale rückwärts wenden, wo ein "Vorne" sich nicht zeigen will. Deshalb stellen sie dar, was und wie sie den Menschen von dort aus sehen: als Bruchstück, zerrissen und desillusioniert. Indem die Kunst unserer Zeit die Zerrissenheit darstellt, läßt sie sich bewußt oder unbewußt auf die Scheidelinie zwischen Vernunft und Transzendenz ein, arbeitet somit negativ für die Überwindung der Stagnation. Diese kann nicht in einem "Großen Zurück" und in "der Illusion des schönen Scheins" gefunden werden (wie es etwa Nietzsche im dionysischen Chaos des Übermenschen propagiert), und meines Erachtens auch nicht in der "Schönheit" wissenschaftlicher Theorien (S. Weinberg), sondern bedeutet immer eine erneute Gewissenschärfung verbunden mit dem Gedanken, daß es doch sehr merkwürdig wäre, ausgerechnet mit dem jeweiligen "Heute" ein abruptes Ende der Möglichkeiten der Evolution anzunehmen; daraus aber folgt die Notwendigkeit, sich zu dieser Offenheit hin aktiv zu verhalten, um die kulturelle Evolution des Menschen in Wechselwirkung mit den Fähigkeiten seines Gehirns in Gang zu halten. Anmerkungen: (1) Ausgabe vom 22. August 1997, S. 34 (2) Hervorhebungen durch den Verf. (3) Crick, S. 32: "Nach modernen Maßstäben kann Freud kaum als Wissenschaftler betrachtet werden; vielmehr war er ein Arzt mit vielen neuen Ideen, die er überzeugend und ungewöhnlich gut formulierte. Er wurde zum Hauptbegründer des neuen Kults der Psychoanalyse." Problematisch scheint mir der Ansatz von Crick‘s Buch zu sein: Er meint, in seinen Untersuchungen spezielle Areale für ein "visuelles Bewußtsein" finden zu können, ohne darauf aufmerksam zu sein, daß sowohl das rationale Bewußtsein der Menschen wie das Empfindungsbewußtsein höherer Tiere auf ein im Heranwachsen erworbenes Vorverständnis angewiesen ist, das so etwas wie "Bewußtsein" überhaupt erst ermöglicht. Von daher kann es ein rein visuelles Bewußtsein aber gar nicht geben, weil auch bereits zum Sehen selbst verschiedenster Kontext dieses Vorverständnisses von Ratio und Emotio mitherangezogen wird. Selbst wenn also beim Augenarzt mittels Zahlen und Alphabet die Sehkraft und -schärfe getestet werden, muß die Ratio bereits mit außervisuellen Arealen zum Vorverständnis dieser Zeichen beteiligt sein. Daher kann es folglich nicht gelingen, auf diesem Weg jene neuralen Areale zu ermitteln, die allein mit dem visuellen Bewußtsein in Zusammenhang stünden. (4) Gardner, S. 18 (5) lat. emergere – sich zeigen, auftauchen, sich herausarbeiten; zur modernen Verwendung dieses Begriffes vgl. Vollmer, Auf der Suche nach Ordnung, S. 70 und Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, S. 81/82: "Für Physiker, Chemiker, Kybernetiker, Systemtheoretiker und Gestaltpsychologen ist nämlich das Auftreten völlig neuer Systemeigenschaften durch die Vereinigung von Untersystemen etwas ganz Natürliches. ... Die Eigenschaften eines Systems können sich also wesentlich (qualitativ!) von denen seiner Teile unterscheiden. Diese Tatsache ist für einige der wichtigsten zur Zeit diskutierten Probleme relevant: für die Frage der Entstehung des Lebens, für das Reduktionsproblem (Rückführbarkeit der Biologie auf Physik und Chemie), für die Gestaltpsychologie (das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile), für die Evolution des Bewußtseins oder auch für psychophysisches Probleme. Leben Bewußtsein, Erkenntnisfähigkeit sind nämlich Systemeigenschaften und nur als solche verständlich." (Hervorhebungen d. Verf.) (6) Informationsspeicherung hat die Natur schon mit dem Hervorbringen des Lebens selbst auf seiner vegetativen Stufe im Wege der DNA "gelernt", doch stellt sie hier den "Individuen" noch kein "Wissen" zur Verfügung, sondern die Lebewesen "sind" dieses Wissen.– (7) vergl. de Waal, S. 50/51: "Entenküken und junge Gänse haben keine genaue Kenntnis ihrer Spezies, wenn sie auf die Welt kommen; sie nehmen in den ersten Stunden ihres Lebens entsprechende Informationen auf. Normalerweise geschieht dies, indem sie ihre Mutter beobachten und ihr folgen; es kann jedoch auch passieren, daß sie irgend ein anderes bewegliches Objekt als Anhaltspunkt wählen, wenn sie während der aufnahmebereiten Phase darauf stoßen.... Der Wissenschaft ist es ... gelungen, Vögel dazu zu bringen, Spielzeuglastwagen und bärtigen Zoologen zu folgen. Diesen Vögeln ist also weniger ein detailliertes Wissen über ihre Spezies angeboren, als vielmehr eine Neigung, sich dieses Wissen in einem kritischen Lebensstadium anzueignen." (8) Es handelt sich bei der "Emotio" um ein System, das nicht an einer einzelnen Stelle des Gehirns geortet werden kann, sondern verschiedene Strukturen miteinander verbindet und selbst wieder mit den über und unter ihm liegenden "Großsystemen" verbunden ist: zu ihrem Bestand zählt man subcortical etwa das limbische System, die Amygdala und cortical eigene repräsentierende Rindenfelder. (9) Poetisch bezeichnen wir das Feuern beider Schichten, vor allem wenn sie uns gegensätzliche Ergebnisse aufdrängen, etwa mit "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust ...": wir können zwischen voneinander abweichenden Urteilen von Ratio und Emotio oft nur schwer wählen. Aber auch noch dasjenige, was wir "Gewissen" nennen, können wir aus dieser Sachlage ableiten: wenn wir gegen konditionierte oder selbst erworbene Werte der Vernunft zugunsten von Werten aus Verstand oder Emotio verstoßen wollen, meldet sich in uns die "Stimme des Gewissens" als Feuern jenes Wertezentrums, das eine höhere Akzeptanz verlangt als die vor ihm liegenden. (10) Auf linguistischer Ebene spricht man hier von "Hintergrundwissen", das die Voraussetzung bildet, daß sich Menschen mittels Sprache verständigen können, und das durch neue Erfahrungen selbst wieder verändert wird. In diesem Umstand ist die Hauptschwierigkeit zu finden, warum sich menschliche Erkenntnisverfahren kaum auf Computer (KI) übertragen lassen. (11) Man denke etwa an den "Pawlow‘schen Hund": Indem man ihm sein Fressen zugleich mit dem Glockenschlag vorsetzt, werden die positive Empfindung, die der Geruch der Nahrung auslöst, die Magensekretion und der Klang assoziiert mit der Folge, daß allein schon der Klang die Sekretion auszulösen vermag. Diese emotional assoziierende Speicherung von Sinnesereignissen liefert die Datenbasis für den Verstand, der die Einzelsinnesereignisse vereinigend auf einen Wirkungsträger als Ding zurückführt und als Gesamt unter dem "Begriff" speichert. (12) Vgl. Verf., "Was ist Metaphysik?" in A&K 1/1997, S. 61 f. Diese sich aus meiner Theorie ergebende Definition steht in Übereinstimmung mit den Überlegungen des theoretischen Neurophysiologen William H. Calvin, S. 73: "Sprache ist das Hauptmerkmal menschlicher Intelligenz. Ohne Syntax – ohne systematisches Ordnen verbaler Ideen – wären wir nur wenig schlauer als ein Schimpanse." – (13) "Was ist Metaphysik?", S. 67 f. In ganz ähnlichen Worten beschreibt Dennett, Kap. 13 die Herkunft des "Ich". (14) Wie ich zu meiner Überraschung herausfand, gehen Damasio‘s Überlegungen (S. 353, Anm. 1) in eine ganz ähnliche Richtung: "Wie der Leser noch feststellen wird, unterscheide ich auch zwischen Gefühl (emotion) und Empfindung (feeling). In der Regel meine ich mit ‚Gefühl‘ eine Reihe von Veränderungen, die in Hirn und Körper stattfinden und gewöhnlich durch einen bestimmten geistigen Inhalt ausgelöst werden. Eine Empfindung ist die Wahrnehmung dieser Veränderungen." Allerdings ist der Wortgebrauch genau umgekehrt wie hier – offenbar weil das englische Sprachgefühl das nahelegt: "feeling" scheint der menschlichen Ratio näherzustehen als "emotion"; hingegen kann der Deutsche zwar sagen: "ich fühle mich wohl", nicht aber, "ich empfinde mich wohl". Daher scheint mir im Deutschen der Begriff "Gefühl" der Ratio näherzustehen als der Begriff "Empfindung": das Empfinden ist ein unpersönlicherer und der individuellen Selbstwahrnehmung fernerstehender Begriff als das Fühlen. (15) Masson/McCarthy, S. 250-252, äußern sich zum Thema Altruismus im Tierreich wie folgt: (16) vergl. de Waal, S. 57f.; m.E. beruhen die meisten anthropomorphen Verwechslungen zwischen tierischer Empfindung und menschlichem Gefühl auf einer ungenügenden Unterscheidung von tierischer und menschlicher Empathie und Sympathie; weil es auf den ersten Blick so aussieht, als ob etwa unser Hund fast ebenso "fühlt" wie wir selbst, unterstellen wir ihm auch unsere eigenen Motive anstatt zu sehen, daß sich sein Nach- und Mitempfinden als Grundlage der Kooperation einer Wolfshorde entwickelte. (17) Masson/McCarthy, S. 258: "Selbst-Bewußtsein gibt es auf emotionaler wie auf intellektueller Ebene. Emotional kann es das Gefühl des Unbehagens sein, beobachtet zu werden (oder sich selbst zu beobachten) – eine Form der Blamage also. Intellektuell ist Selbst-Bewußtsein das Reflektieren über den eigenen Verstand, die eigene Existenz, das eigene Handeln – ein philosophisches Minenfeld. (18) Zu beachten ist auch das griech. Stammwort aisthanomai (empfinden, fühlen, wahrnehmen, verstehen), dessen Wortbedeutung offensichtlich den gesamten Erfahrungsbereich des Verstandes abdeckt; seine deponentiale Form verweist zurück auf das Berührtwerden, also die eigenständige Affizierung des Verstandes, vermittelt durch die Sinne und Emotio. (19) Unter "Transzendenz" wird im gesamten Text nicht irgendetwas Mystisch-Metaphysisches verstanden, sondern dieser Begriff bildet das auf die kulturelle Evolution bezogene Pendant zum Begriff "Emergenz" in der Natur: eine Einstellung, die sich bewußt über den bisher erreichten Status des Menschlichen hinaus bezieht, weil ein Ende der Evolution wohl von niemandem ernsthaft behauptet werden kann. Vgl. auch Anm. 5 oben: Vollmer weist dort einen solchen Wortgebrauch zurück, wie ihn (mir unbekannterweise) schon H. Schriefers einführte. Der Begriff wird hier dennoch beibehalten, weil er mir insbesondere in der kulturellen Evolution des Menschen die notwendige Eigenaktivität besser auszudrücken scheint als die anonyme "Emergenz". Und so enthält der Begriff "Transzendenz" vor allem auch den Akt der (zeitweiligen) Sinnstiftung, die mit dieser kulturellen Evolution ja ebenfalls angesprochen ist. Vgl. Vollmer, Auf der Suche nach Ordnung, S. 15: "Vielleicht erreichen wir ja dabei noch eine weitere, eine fünfte Weltbildstufe, eine Stufe etwa, auf der – wie in den Mythen – Fakten und Normen wieder zusammengehören ..." (20) Selbst in der Naturwissenschaft wird von "Schönheit" gesprochen, etwa der "Schönheit von Theorien"; dies geht etwa bei Steven Weinberg soweit, daß er die "Schönheit" einer Theorie zu einem Wahrheitskriterium derselben macht. (21) "schön und gut" – siehe hierzu auch die reflexiven Nachahmungsversuche durch die Aufklärung: als "gentleman" beziehungsweise "honette homme" (22) Leakey/Lewin bieten einen Überblick über die bisherigen Deutungsversuche der Höhlenmalerei (S. 313 ff.); nach Reinach und Abbé Breuil handelt es sich dabei um Jagdmagie, hingegen vertritt André Leroi-Gourhan die Auffassung, hier würden Strukturen der damaligen Gesellschaft dargestellt, insbesondere in der Trennung von Männlich und Weiblich. Die neueste Deutung geht weniger von der Bedeutung, als vielmehr von der Art der Darstellung aus; so finden sich einerseits geometrische Motive, andererseits gegenständliche Darstellungen, und drittens Mischwesen aus Tier und Mensch. Dies wird als neuropsychologische Theorie zusammengedacht mit dem Zustand des menschlichen Geistes in der Halluzination und deren verschiedenen Stadien (Lewis-Williams): "»Es gab Berichte über visuelle Halluzinationen, sehr genaue Beschreibungen«, sagt er. »Den Forschungen zufolge sieht man im frühen Stadium geometrische Formen, zum Beispiel Gitter, Zickzacklinien Punkte, Spiralen und Kurven.« Diese Bilder, insgesamt sechs verschiedene Typen, schimmern weißglühend, lebhaft – und voller Kraft. Solche sogenannten entoptischen Bilder – der Begriff bedeutet »nach innen gesehen« – entstehen durch die grundlegende Struktur der Nervenzellen im menschlichen Gehirn. »Da sie aus dem Nervensystem stammen, sind alle Menschen in bestimmten veränderten Bewußtseinszuständen in der Lage, sie wahrzunehmen, unabhängig vom kulturellen Hintergrund«, sagt Lewis-Williams. Im zweiten Stadium der Halluzination versuchen die Menschen solchen Bildern einen Sinn zu geben. Was dabei herauskommt, hängt von der Kultur und den gegenwärtigen Lebensumständen des einzelnen ab. Eine Reihe von Kurven kann als Hügelkette gedeutet werden, wenn der Betreffende an ländliche Gegenden denkt, oder aber als Wellen, wenn seine Gedanken sich mit Schiffahrt beschäftigen. Die Schamanen der San machen aus Kurvenreihen häufig Bilder von Bienenwaben, denn Bienen sind ein starkes Symbol übernatürlicher Macht, das sich diese Leute zunutze machen, wenn sie in Trance verfallen. (23) Genau dies leistet die einerseits parallele und signalverarbeitende, andererseits seriell-schichtweise Projektion der Neuronen vom Sinnesorgan zu den Repräsentanz- hin zu den Interpretationsfeldern. (24) Was beweist, wie gering der Abstand selbst – oder gerade?! – vieler "Hochgestellter" noch heute von ihren Ahnen ist. (25) Nicht zufällig vereint der Grieche unter dem Begriff téchne die für uns heute völlig verschiedenen Bedeutungen von Kunst, Kunstfertigkeit, Kunstwerk und Wissenschaft. Die Kenntnis von Regeln und die Einsicht in das Wesentliche machen den Künstler aus im Gegensatz zu unserem modernen Geniekult. (26) Dies gilt sicher auch heute noch, man sehe etwa den Gigantismus eines Napoleon III. und von Mitterand in Paris – und das eigentlich Dämonische (= Unvernünftig-Zurückgreifende) solcher Bauweise zeigen die Bauten und Planungen Hitlers... (27) Joh. Chr. Fr. Hölderlin "Hyperion", Erstes Buch, 2. Brief an Bellarmin Literatur: William H. Calvin, Die Entstehung von Intelligenz, in Spektrum der Wissenschaft, Spezial 3: Leben und Kosmos, S. 70 ff. Francis Crick, Was die Seele wirklich ist – Die naturwissenschaftliche Erforschung des Bewußtseins, Rowohlt TB Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Juni 1997 (Originalausgabe 1994) Antonio R. Damasio, Descartes‘ Irrtum, Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, dtv, 2. Aufl. 1997 Daniel C. Dennett, Philosophie des menschlichen Bewußtseins, Hoffmann & Campe 1994, Kap. 13 Howard Gardner, Dem Denken auf der Spur, Klett-Cotta, Stuttgart 1989 Richard Leakey/Roger Lewin, Der Ursprung des Menschen, Fischer TB, Frankfurt 1998 (1992/3) Jeffrey M. Masson/Susan McCarthy, Wie Tiere fühlen, Rowohlt TB, Reinbek 1997 Gerhard Vollmer, Auf der Suche nach Ordnung, S. Hirzel Verlag, Stuttgart1995 Gerhard Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, S. Hirzel Verlag, Stuttgart1994 Frans de Waal, Der gute Affe – Der Ursprung von Recht und Unrecht bei Menschen und anderen Tieren, C. Hanser Verlag München-Wien 1997 Hier finden Sie zwei Grafiken zum Überblick über den Aufbau des Gehirns sowie die zentrale Funktion des Thalamus aus Francis Crick's Buch. Beachten Sie bitte auch die weitere Grafik zur Struktur des Bewußtseins, die Ihnen die hier vorgeführte Theorie verdeutlichen kann (s. a. Link auf der Homepage). Dazu neu: Schönheit entsteht im Gehirn Dr. Peter Huch stellt im Internet seine eigenen Überlegungen zum Ursprung der Kunst vor;
ihm geht es dabei es um die Evolution des menschlichen Schönheitssinnes
und eine weitere Sichtweise: Die Entstehung der Kultur als Standesmerkmal. Sie sind der
|